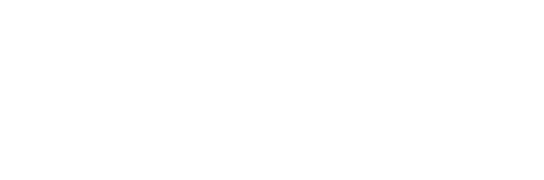WOLF – LUCHS – BÄR
Wenn Angst tötet
Sind große Beutegreifer im Revier, verändert Wild nicht nur sein Verhalten, auch die Auswirkungen auf den Bestand sind spürbar. Dr. Christine Miller hat recherchiert.

Bild: Rafal Lapinski
Wenn Wolf oder Luchs durchs Revier streifen, stellen sich ihre potenziellen Beutetiere sehr schnell darauf ein. Schließlich haben Jahrhunderte ihre Spuren im Verhaltensrepertoire von Reh und Hirsch hinterlassen. Grundsätzlich sind Wildtiere gut ausgestattet, mit ihren natürlichen Feinden zurechtzukommen. Jedoch nur dann, wenn sie in einer Welt leben, in der sie sich ihren Lebensraum nach Bedarf suchen können und nicht noch einem dritten, äußerst effizienten „Beutegreifer“ ausweichen müssen – dem Mensch.

Doch die Flucht kostet zusätzlich Energie und umso mehr, je länger die Strecke, je steiler oder schwieriger der Weg und je mehr Schnee liegt. Doch anstatt jetzt schnell die Energiereserven wieder aufzubauen, ist das betroffene Tier in der Regel gezwungen, in weniger guten Einständen auszuharren. Und was, wenn auch dort Gefahr droht, wenn Störungen nicht mehr aufhören? Der Körper bleibt dann in dauerhaftem Alarmzustand. Sowohl im Verhalten wie in messbaren, körperlichen Veränderungen schlägt sich dieser Dauerstress nieder. Die Folgen sind weitreichend: mehr Hunger, mehr Nahrungsaufnahme, mehr Schäden, z. B. Schäle. Übrigens können auch gestörte Sozialstrukturen zu dauerhaft empfundenem Stress führen, mit den gleichen Konsequenzen. Lebensbedrohliche Vorfälle, eine Verletzung oder auch der hautnah erlebte Verlust eines Kalbes oder Kitzes können zudem lang- andauernde, manchmal lebenslange Auswirkungen auf das Gehirn haben und ähnlich wirken wie posttraumatische Belastungsstörungen beim Menschen. Furcht verändert auch Strukturen im Gehirn. Dort sitzt im Zentrum die Amygdala, in der Emotionen verarbeitet werden und in der auch eine Art „Furcht-Gedächtnis“ angelegt wird. Langfristig können diese Veränderungen auch auf die Nachkommen übertragen werden. Dauergestresste Mütter haben deutlich nervösere und weniger robuste Jungen.
Anders als menschliche Jäger sind Wolf und Luchs nicht schon von Weitem an einem Motorengeräusch oder Hundegebell erkennbar. Hirschkuh und Reh müssen daher immer wieder sichern und die Luft auf verdächtige Gerüche, Geräusche und Bewegungen absuchen. Das Sichern kostet Zeit. Zeit, die für Nahrungssuche, für das Äsen und für das Verdauen fehlt. Vor allem bei wiederkäuenden Pflanzenfressern bringen Störungen, dadurch ausgelöste Ortswechsel und Fluchten die Verdauungstätigkeit durcheinander. Im schlimmsten Fall kann die Störung der Pansenaktivität auch zu Übersäuerung des Pansenmilieus führen. Beim Aufschluss von Kohlehydraten im Pansen werden flüchtige Fettsäuren erzeugt, die den Panseninhalt immer saurer werden lassen. Durch das Wiederkäuen wird Speichel abgeschluckt, der den pH-Wert im Pansen abpuffert. Wird Wild beim Wiederkäuen immer wieder aufgemüdet, wird der Panseninhalt immer saurer. Um das zu kompensieren und die Schmerzen durch Übersäuerung zu lindern, nehmen sie dann gezielt Baumrinde oder tanninreiche Pflanzenteile auf.
Ein Mittel, die Kosten für Wachsamkeit zu reduzieren, liegt im Zusammenschluss zu größeren Gruppen. Viele Lichter sehen eben mehr. Das einzelne Tier muss weniger Zeit für Sichern und Aufmerksamkeit aufwenden, allerdings zum Preis erhöhter innerartlicher Konkurrenz oder der Übernutzung kleiner, konzentrierter Einstände. Daher lieben potenzielle Beutetiere den Überblick, damit sie nicht so leicht überrascht werden können. Rotwild entwirft eine ganz neue Landkarte der Raumnutzung, wenn Wölfe in ihrem Lebensraum auftauchen. Wie von der Natur vorgesehen, bevorzugen sie dann offene Einstände und nicht mehr Dickungen und geschlossene Wälder. Doch auch Wölfe passen sich laufend an die veränderte Habitatnutzung ihrer Beutetiere an, genauso wie an die Häufigkeit von menschlichen Störungen und das Wege- und Straßennetz, das ihnen die Jagd und Fortbewegung erleichtert. Die Größe und die Verteilung von Wolfsrudeln wandeln sich daher, wie die sehr detaillierten und langfristigen Studien zu den Wölfen im Yellowstonegebiet zeigen.


Wird dauerhaft auf Rehe Druck gemacht, steigt der Einfluss auf das Verhalten und die Ausprägung dauerhafter Stressreaktionen, was letztendlich zu deutlichen Einbrüchen in der Rehpopulation und der menschlichen Rehstrecke führen kann. Der Einfluss von Luchsen auf eine Rehpopulation muss daher großräumig und im Jahreslauf gesehen werden. Das durchschnittliche Streifgebiet eines Luchses ist groß, zwischen 7 200 und 22 100 ha, ein Kuder kann bis zu 36 000 ha im Laufe eines Jahres als sein Jagdgebiet betrachten. Doch eine Katze, die Junge führt, muss sich zwangsläufig in ihrem Aktionsraum einschränken. Während im Durchschnitt bei einem Kuder etwa 12 bis 20 km zwischen 2 aufeinander folgenden Rissen liegen, sind es bei einer Luchsin ohne Junge etwa 6, mit Jungen dagegen im Schnitt nur noch 2,5 km. Gleichzeitig ist ihr Nahrungsbedarf höher und liegt bei bis zu 7 kg ab November, wenn auch die Kleinen merkbaren Appetit haben. Wird der Jagddruck durch den Menschen hier nicht entsprechend zurückgefahren, kann auch die Rehpopulation diesen Druck nicht mehr aushalten. Das geht umso rasanter, je weniger produktiv die Landschaft für das Rehwild ist. Daher kann den Luchs nur erhalten, wer sorgfältig auf die Zuwachsraten seiner Rehpopulation achtet. Etwas, das in Deutschland unüblich bis verpönt ist.

Diese Gleichung geht nicht auf, weil sie die zusätzlichen Auswirkungen von Beutegreifern auf die Beutepopulationen außer Acht lässt. Zusätzlich steigt die Rissrate von Wölfen, Luchsen und anderen untersuchten Raubtieren, wenn das betroffene Gebiet von Menschen stark beeinflusst wird. Nicht nur die Beutetierbestände können sich dann nicht auf das zusätzliche Risiko einstellen. Auch die Wölfe oder Luchse müssen mehr Beute schlagen. Anstatt ein einmal gerissenes Tier über längere Zeit komplett zu nutzen, können sie dann nicht über mehrere Tage an einen Riss zurückkommen. Zwangsläufig muss ein weiteres Tier gerissen werden. Der Wolf mit seinem großen Nahrungsspektrum kann es in der Regel kompensieren, wenn die Schalenwildpopulation zusammenbricht. Er weicht dann auf andere Arten, wie Weidevieh aus. Der Luchs mit seinem engeren Nahrungsspektrum ist gezwungen, das Gebiet zu verlassen. Der Revierinhaber hat diese Möglichkeiten nicht.
Autor: Dr. Christine Miller